So., 21.05.23 | 23:35 Uhr
Das Erste
Die offene Gesellschaft in der Krise
Viel ist in Bewegung gekommen in diesen Krisenjahren. Alles sehr überreizt. Es reicht ein nicht ganz ausgereiftes Heizungsaustauschgesetz und die Empörung wird epochal. Alles ist verbockt. Und dann auch noch dieses Gendern. Und der Schweinsbraten wird auch verboten. Schlimme neue Welt.
Wokeness? Bitte nicht in Bayern!
"Gerade in Bayern hat man auf dem Land das Gefühl, dass die Leute gar nicht mehr so sprechen dürfen wie sie wollen und dass die Woken den Leuten bald die Insektenburger vorschreiben", sagt der Soziologe Oliver Nachtwey.

"Es sieht nicht so aus, dass das der Realität entspricht, aber wenn man sich gerade die politischen Äußerungen des bayerischen Ministerpräsidenten anschaut, dann sieht, dass er das sehr stark zu adressieren versucht. Hier kann man etwas erzeugen. Hier kann man eine Wut, eine Hitze erzeugen. Das versucht er mitzunehmen. Das sehen wir bei vielen Elementen. Und deshalb ist diese Debatte häufig auch etwas medial politisch Erzeugtes und weniger in der Bevölkerung Verankertes, als wir häufig denken."
Das Gefühl des Verbots verselbstständigt sich
Die Soziologen Carolin Amlinger und Oliver Nachtwey haben sich die jüngsten Entwicklungen in unserer Gesellschaft genauer angesehen. Eine "libertäre" Gesellschaft, in der über Jahrzehnte die freie Entfaltung des einzelnen über alles ging. Und jetzt soll es plötzlich wieder Beschränkungen geben. "Wir beobachten eine Tendenz, dass sich dieses Gefühl des Verbotes, des Verzichtes verselbständigt und zu einer Art Welterfahrung wird", sagt Carolin Amlinger. "Wenn man einmal das Gefühl hat, nicht mehr das sagen zu können, was man will, dann verallgemeinert sich das."
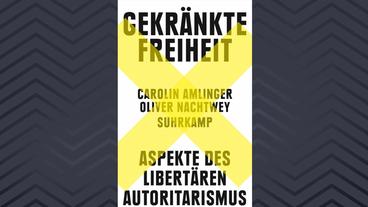
"Dieses Gefühl", das manche haben. Besonders seit Corona. Klar: Massive Einschränkungen für den Einzelnen. Der Staat wollte vulnerable Menschen schützen. Doch da war der quer denkende Geist der Fundamentalkritik schon aus der Flasche. "Ein Element ist eben auch, dass sich die Kritik losgelöst hat von den Inhalten", sagt Amlinger. "Es geht jetzt weniger darum, was konkret kritisiert wird, sondern dass kritisiert wird. Man nimmt permanent die Rolle der kritischen Kritikerin oder des kritischen Kritikers ein, um eben am Staat, am Establishment Kritik zu üben."
Kritik kommt heute aus allen Lagern
Die Befreiung des Einzelnen aus den engen Konventionen der Nachkriegszeit war mal eine linksliberale Angelegenheit. Mittlerweile kommt die Kritik am Staat und an den Regierenden aus allen möglichen Lagern. Heutige sogenannte Libertäre bewegen sich quer durchs Spektrum. Gegen Waffenlieferungen etwa sind ganz Rechte und ganz Linke. Eines haben sie gemeinsam: wenig Empathie für die eigentlichen Opfer.

"Es wäre zum Beispiel denkbar, dass es große friedenspolitische Demonstrationen gibt, die sich gegen Putin wenden", sagt Nachtwey. "Nicht, dass der Aufruf nach Frieden und Diplomatie als solches diskreditiert wird, sondern das spezifische Wording. Wenn wir uns noch mal Sahra Wagenknecht anschauen, dann gab es teilweise nur einen Satz, in dem Putin genannt wurde. Aber am Ende war es dann doch eher Selenskyj, der der Kriegstreiber ist und die Ukraine wurde aufgefordert mehr oder weniger aufzugeben."
Dogmatismus schadet dem Fortschritt
Und dann sind da noch diese Klimaterroristen, die mit ihrer Klimasekte eine Klimadiktatur errichten wollen. So, so. Über die Mittel mag man streiten. Eigentlich wollen sie nur, dass die Erde bewohnbar bleibt. Dafür müsste jeder einzelne auf das eine oder andere verzichten. "Aber für uns ist das wirklich entscheidende Phänomen diese wütende Reaktion auf diese jungen Leute. Und das muss einen bedenklich stimmen", sagt Nachtwey.

"Diese Wut, die den Klimaprotesten entgegengebracht wird, ist ein Indiz darauf, dass die kommenden Konflikte um Freiheit eher noch zu- als abnehmen werden", sagt Amlinger. Und tatsächlich. Einiges sollte vielleicht nochmal diskutiert werden: zum Beispiel, ob allein eine Frisur oder ein Musikstil schon kulturelle Aneignung sein können. Dogmatismus schadet dem notwendigen Fortschritt.
Viele, die sich auf "Freiheit" berufen, meinen ausschließlich ihre eigene
"Dann gibt es Teile in der woken Bewegung, die das sehr rigide vertreten", sagt Nachtwey. "Aber meine persönliche Erfahrung ist: wenn man damit freundlich und respektvoll umgeht, kommt man auch ins Gespräch. Ein simples Beispiel. Ich hab eine Studierende bei mir im Seminar, die möchte ohne Pronomen angesprochen werden. Ich habe es gemacht und ich habe es vergessen. Anschließend bin ich zu ihr hingegangen und habe gesagt: 'Ich weiß, Sie möchten gerne ohne Pronomen angesprochen werden. Es tut mir leid, ich hab es jetzt zweimal vergessen.' Dann sagt sie: 'Gar kein Problem.'"

Die Freiheit des einzelnen endet dort, wo die Freiheit des anderen beginnt. Viele, die sich auf die "Freiheit" berufen, meinen damit ausschließlich ihre eigene, ihre momentane. "Es gibt eine Form von Abhängigkeitsvergessenheit, also fast eine Form von Leugnung, dass man nicht sehen möchte, dass der Staat unser soziales Leben gewährleistet durch funktionierende öffentliche Infrastruktur. Das wird ausgeblendet und nicht gesehen. Stattdessen wird dann die eigene Freiheit besonders radikal hervorgehoben."
Was in diesem Denken nicht vorkommt: das Leben der Anderen. Die Zukunft. Die sogenannten Libertären sparen das aus. Ich! Nein. Uns läuft die Zeit davon.
BUCHTIPP
Carolin Amlinger / Oliver Nachtwey: "Gekränkte Freiheit. Aspekte des libertären Autoritarismus", Suhrkamp Verlag
Autor: Norbert Haberger
Stand: 21.05.2023 19:40 Uhr




Kommentare