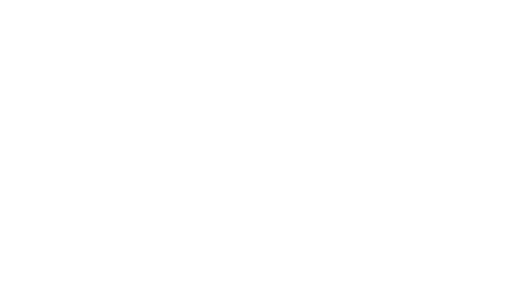Faktencheck zu "maischberger"
Sendung vom 28.11.2023
Faktencheck

Bei Maischberger wird engagiert diskutiert, Argumente werden ausgetauscht, es wird auch schon mal emotional und manchmal bleibt am Ende keine Zeit, um alles zu klären. Wenn Fragen offen bleiben, Aussagen nicht eindeutig waren oder einfach weitere Informationen hilfreich sein könnten, schauen wir nach der Sendung noch einmal drauf – hier in unserem Faktencheck.
Und das schauen wir uns an:
- Welche Voraussetzungen gibt es für vorgezogene Neuwahlen?
Welche Voraussetzungen gibt es für vorgezogene Neuwahlen?
Unsere Kommentatoren diskutierten in der Sendung über die Möglichkeit vorgezogener Neuwahlen, wie sie z.B. vom bayerischen Ministerpräsidenten Markus Söder gefordert werden. Welche Voraussetzungen erfüllt sein müssten, damit es zu Neuwahlen kommen könnte, wollen wir uns hier noch einmal genauer anschauen.
Maischberger: "Also derjenige, der Neuwahlen fordert, ist ja der bayerische Ministerpräsident Markus Söder. Er sagt: 'Wir befinden uns in einer Staatskrise. Die Ampel hat nicht mehr die Kraft, die Probleme zu bewältigen. (…) Vorgezogene Neuwahlen wären der richtige Weg. Die Ampel sollte dem deutschen Volk die Vertrauensfrage stellen.' Sie glauben nicht, dass es dazu kommt, Herr Blome?"
Blome: "Also, wenn sich alle am Tisch rational verhalten, kommt es dazu nicht, weil keine der im Moment die Regierung tragenden Parteien ein Interesse daran haben kann, in Wahlen zu gehen. Die Betonung liegt auf dem Wörtchen 'rational'. Wenn einer anfängt durchzudrehen, weil er gar nicht mehr kann und gar nicht mehr weiterweiß, dann steht er auf und geht, und dann gibt’s Neuwahlen."
Hintergrund: Welche Voraussetzungen gibt es für vorgezogene Neuwahlen?
Laut Artikel 39 des Grundgesetzes (GG) wird der Bundestag für eine Dauer von vier Jahren gewählt. Der aktuelle Deutsche Bundestag kam am 26. Oktober 2021 zu seiner konstituierenden Sitzung zusammen. Demzufolge würde die nächste Bundestagswahl im Jahr 2025 stattfinden. Unter besonderen Umständen können die Wahlen aber auch vorgezogen werden. Dies erfordert zunächst die Auflösung des Bundestags.
Wer darf den Bundestag auflösen?
Laut Artikel 68 GG ist ausschließlich der Bundespräsident befugt, den Bundestag aufzulösen. Der Bundeskanzler und auch das Parlament können die Auflösung nicht herbeiführen. Der Bundespräsident kann das Parlament jedoch nicht ohne Grundlage für aufgelöst erklären, sondern muss sich aus Gründen der politischen Stabilität an ein bestimmtes Verfahren halten, das im Grundgesetz festgeschrieben ist. Demnach ist es notwendig, dass das Parlament dem Bundeskanzler zunächst das Vertrauen entzieht. Dies geschieht durch die sogenannte Vertrauensfrage (siehe unten). Hat der Bundestag dem Bundeskanzler das Vertrauen entzogen, kann der Bundespräsident auf Vorschlag des Bundeskanzlers das Parlament auflösen.
Wie funktioniert die Vertrauensfrage?
Wie der Begriff schon sagt, dient die Vertrauensfrage dem Bundeskanzler dazu, per Abstimmung festzustellen, inwieweit er noch den Rückhalt des Parlaments genießt. Wird dem Kanzler das Vertrauen mehrheitlich entzogen, kann er dem Bundespräsidenten die Auflösung des Bundestags binnen 21 Tagen vorschlagen. Stimmt der Bundespräsident dem Vorschlag zu, gibt es innerhalb der nächsten 60 Tage Neuwahlen.
Formal gesehen kann also die Ampel-Regierung dem "deutschen Volk" keine Vertrauensfrage stellen, wie Markus Söder zuletzt forderte. Die Vertrauensfrage richtet sich immer an das Parlament. Erst wenn das Parlament dem Bundeskanzler das Vertrauen entzieht und daraufhin vom Bundespräsidenten aufgelöst wird, können die Bürger zu vorgezogenen Neuwahlen an die Urne treten.
Gab es in Deutschland schon mal vorgezogene Neuwahlen?
Ja. Seit der Gründung der Bundesrepublik Deutschland im Jahr 1949 ist es dreimal zu Neuwahlen nach einer gescheiterten Vertrauensfrage gekommen. Die Bundeskanzler Willy Brandt (1972) und Helmut Kohl (1982) wurden bei den vorgezogenen Neuwahlen jeweils im Amt bestätigt. Gerhard Schröder scheiterte 2005 bei dem Versuch, es ihnen gleichzutun. Seine SPD wurde nur zweitstärkste Kraft und ging als Juniorpartner in eine Große Koalition unter Bundeskanzlerin Angela Merkel.
Schröder hatte die Vertrauensfrage damals nach einer deutlichen Niederlage seiner SPD bei der Landtagswahl in NRW gestellt. Dieses NRW-Wahlergebnis habe "die politische Grundlage für die Fortsetzung unserer Arbeit in Frage gestellt", erklärte Schröder kurz darauf. Er bezeichnete es deshalb als seine "Pflicht und Verantwortung, darauf hinzuwirken, dass der Herr Bundespräsident von den Möglichkeiten des Grundgesetzes Gebrauch machen kann", vorgezogene Neuwahlen herbeizuführen. Schröder stellte die Vertrauensfrage also mit der klar geäußerten Absicht, sie zu verlieren. Inwieweit dies zulässig ist, gilt unter Verfassungsrechtlern als umstritten. Das Bundesverfassungsgericht erklärte das Vorgehen damals für rechtmäßig.
Was versteht man unter einem konstruktiven Misstrauensvotum?
Während die Vertrauensfrage aktiv vom Bundeskanzler gestellt wird, kennt das Grundgesetz auch ein Instrument, mit dem das Parlament von sich aus dem Bundeskanzler das Vertrauen entziehen kann. Das ist das sogenannte konstruktive Misstrauensvotum. Anders als die Vertrauensfrage kann dieses aber nicht zur Auflösung des Parlaments führen. Wesentlich für das konstruktive Misstrauensvotum ist nämlich, dass dem Bundeskanzler das Vertrauen entzogen und gleichzeitig ein neuer Bundeskanzler gewählt wird. Das kam in der bundesrepublikanischen Geschichte bislang nur einmal vor: Im Jahr 1982 entließen die Bundestagsabgeordneten den Kanzler Helmut Schmidt und wählten Helmut Kohl zu seinem Nachfolger.
Wie wahrscheinlich sind Neuwahlen zum jetzigen Zeitpunkt?
Wie in der Sendung wiederholt gesagt wurde, gilt es unter Beobachtern als unwahrscheinlich, dass Olaf Scholz die Vertrauensfrage stellen wird, um den Weg für Neuwahlen freizumachen. Denn geht man nach aktuellen Umfragen, wären Neuwahlen wohl gleichbedeutend mit einer Niederlage für die Ampel-Parteien. Laut dem RTL/ntv Trendbarometer vom 28.11.2023 würden die Koalitionäre momentan nur noch auf gemeinsame 34 Prozent kommen. Die FDP liegt in den Umfragen aktuell nur noch bei etwa fünf Prozent. Für sie könnten Neuwahlen also sogar das Ausscheiden aus dem Parlament bedeuten.
Sollte sich die Koalition auflösen, führt das übrigens nicht automatisch zu Neuwahlen. Theoretisch könnten SPD und Union eine neue Koalition bilden. Voraussetzung hierfür wäre jedoch, dass sich die Union mit ihrer Rolle als Juniorpartner zufriedengibt. Ob sich die Union darauf einlassen würde, ist aber ebenso fraglich wie die Bereitschaft der SPD, in eine Große Koalition einzutreten.
Fazit: Wesentliche Voraussetzung für vorgezogene Neuwahlen ist die Auflösung des Bundestags. Diese kann laut Grundgesetz nur der Bundespräsident herbeiführen, nachdem das Parlament dem Bundeskanzler das Vertrauen entzogen hat. Nach Auflösung des Bundestags gibt es binnen 60 Tagen Neuwahlen. Seit der Gründung der Bundesrepublik Deutschland war das insgesamt dreimal der Fall, zuletzt im Jahr 2005. Dass es in der aktuellen Lage zu Neuwahlen kommt, gilt unter Beobachtern als unwahrscheinlich, weil die Ampel-Koalitionäre nach derzeitigen Umfragen durchweg an Stimmen verlieren würden.
Stand: 29.11.2023
Autor: Tim Berressem