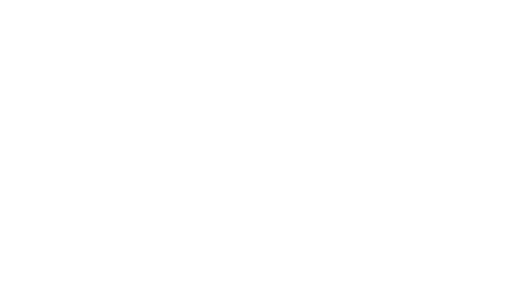Faktencheck zu "maischberger"
Sendung vom 14.05.2025
Faktencheck

Bei Maischberger wird engagiert diskutiert, Argumente werden ausgetauscht, es wird auch schon mal emotional und manchmal bleibt am Ende keine Zeit, um alles zu klären. Wenn Fragen offen bleiben, Aussagen nicht eindeutig waren oder einfach weitere Informationen hilfreich sein könnten, schauen wir nach der Sendung noch einmal drauf – hier in unserem Faktencheck.
Und das schauen wir uns an:
- Ist die Führungsriege der neuen Koalition überwiegend männlich besetzt?
- Führt Schwarz-Rot die Kraftwerksstrategie von Robert Habeck fort?
Ist die Führungsriege der neuen Koalition überwiegend männlich besetzt?
Kristina Dunz bemängelte in unserer Sendung das Geschlechterverhältnis innerhalb der neuen Regierungskoalition. Die Führungspositionen bei Union und SPD seien – mit einer Ausnahme – durchweg männlich besetzt, so Dunz.
Dunz: "Bei dieser Koalition ist die Führungsriege, die im Koalitionsausschuss auch sitzen wird, männlich – plus Frau Bas. Wir haben drei Männer als Generalsekretäre der Parteien. Wir haben drei Männer als Fraktionsvorsitzende. Wir haben drei Männer als parlamentarische Geschäftsführer."
Burgard: "Aber ein paritätisch besetztes Kabinett. Hälfte Männer, Hälfte Frauen."
Dunz: "Ganz so auch nicht."
Burgard: "48 Prozent, glaube ich, ja."
Dunz: "Und es ist die Ebene der Regierungssprecher männlich. Also das ist wirklich für diese Koalition, glaube ich, ein schlechtes Bild, weil diejenigen, die die Dinge verkünden werden, die Entscheidungen verkünden werden, die Entscheidungen treffen werden, das werden Männer sein. Und das spiegelt die Gesellschaft einfach nicht wieder."
Stimmt das? Ist die Führungsriege der neuen Koalition überwiegend männlich besetzt?
Tatsächlich hat sich das Geschlechterverhältnis mit Antritt der neuen Koalition verändert. Die wichtigen Führungsämter der Regierungsparteien – Parteivorsitz, Generalsekretariat, Fraktionsvorsitz und Parlamentarische Geschäftsführung – werden hier fast ausschließlich von Männern bekleidet, wie Kristina Dunz richtig sagte. Die einzige Ausnahme stellt der SPD-Parteivorsitz dar, der in Form einer Doppelspitze organisiert ist. Lars Klingbeil teilt sich den Posten derzeit mit Saskia Esken, die jedoch bereits ihren Rückzug angekündigt hat. Als Nachfolgerin wird auf dem SPD-Parteitag Ende Juni voraussichtlich Bärbel Bas gewählt werden.
In der Ampel-Koalition hatten vor allem die Grünen für eine ausgeglichenere Verteilung in den wichtigen Führungsämtern gesorgt. Acht Männern standen damals sieben Frauen gegenüber: Saskia Esken (SPD-Co-Vorsitzende), Ricarda Lang (Grünen-Co-Vorsitzende), Emily Büning (Bundesgeschäftsführerin der Grünen), Katharina Dröge, Britta Haßelmann (beide Co-Vorsitzende der Grünen-Fraktion), Katja Mast (Parlamentarische Geschäftsführerin der SPD) und Irene Mihalic (Parlamentarische Geschäftsführerin der Grünen).
In der Reihe der Regierungssprecher gab es damals – neben Steffen Hebestreit und Wolfgang Büchner – mit Christiane Hoffmann ebenfalls eine Frau. Unter Schwarz-Rot sind aber auch diese Posten vollständig männlich besetzt worden (Stefan Kornelius, Sebastian Hille, Steffen Meyer).
Und wie sieht es im Bundeskabinett aus? Jan Philipp Burgard sagte in der Sendung, dass die Ministerposten nahezu paritätisch zwischen Männern und Frauen aufgeteilt seien. Der Blick an den Kabinettstisch zeigt: Acht der insgesamt 17 Bundesminister sind Frauen. Das entspricht einem Anteil von 47 Prozent.
Die Ampel-Regierung unter Bundeskanzler Scholz war 2021 mit einem paritätischen Kabinett (damals noch bestehend aus 16 Ministerien) gestartet: acht Männer, acht Frauen. Durch eine Kabinettsumbildung veränderte sich die Verteilung aber zum Nachteil der Frauen, die in der Folge nur noch sieben der 16 Ministerposten bekleideten.
Fazit: Wie Kristina Dunz in der Sendung korrekt sagte, sind die Führungspositionen innerhalb der neuen Regierungskoalition fast durchweg männlich besetzt. Im Vergleich zur Ampel-Koalition hat sich das Geschlechterverhältnis in den Führungsämtern der Koalitionsparteien stark zulasten der Frauen verändert. Das Kabinett von Bundeskanzler Merz ist dagegen fast paritätisch besetzt. Acht der insgesamt 17 Bundesminister sind Frauen.
Führt Schwarz-Rot die Kraftwerksstrategie von Robert Habeck fort?
Armin Laschet (CDU) und Franziska Brantner (B’90/Grüne) diskutierten in der Sendung u.a. über den Plan der Bundesregierung, neue Gaskraftwerke zu bauen. Laschet sagte, Union und SPD würden in diesem Punkt die Strategie des früheren Wirtschaftsministers Robert Habeck fortführen. Brantner stimmte dem grundsätzlich zu, erklärte jedoch, Habeck habe weniger Kraftwerke bauen wollen, als es seine Amtsnachfolgerin nun vorhat.
Laschet: "Jetzt hat Frau Brantner gerade kritisiert, er (gemeint ist Bundeskanzler Friedrich Merz, Anm. d. Red.) baut neue Gaskraftwerke. Ja, das war Kraftwerksstrategie Robert Habeck. Wir brauchen 25 Gigawatt in Kraftwerken, und dann hat man immer zur Tarnung dahinter geschrieben, '…die auch wasserstofffähig sind', damit es nicht wie ein Gaskraftwerk klingt. Aber logisch ist doch, wenn wir 2030 aus der Kohle aussteigen, jedenfalls im Westen zum großen Teil, braucht man für die Zeit, wo kein Wind und keine Sonne da ist, eine Grundlast. Und dafür braucht man Gaskraftwerke. Und die wollte Robert Habeck und die will Friedrich Merz. Und die werden kommen."
Brantner: "Dass wir Gaskraftwerke brauchen, da sind wir uns absolut einig. Es gab einen Plan, zehn Gigawatt. Wir kritisieren nur, dass Sie jetzt die Anzahl verdoppeln wollen."
Laschet: "25."
Brantner: "Sogar mehr."
Laschet: "25 hattet ihr."
Brantner: "Nein."
(…)
Laschet: "Also, ich habe das eben noch mal nachgelesen. Es war eine Kraftwerksstrategie von Robert Habeck geplant. Im Dezember sollte sie in den Bundestag, dann zerbrach die Koalition, dann konnte man das nicht mehr beschließen. Und da war 17 bis 25 Gigawatt drin. Und jetzt sagt Katherina Reiche 25 Gigawatt."
Stimmt das? Führt Schwarz-Rot die Kraftwerksstrategie von Robert Habeck fort?
Tatsächlich plante bereits der frühere Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (B’90/Grüne) den Bau neuer Gaskraftwerke. Diese sollten als Ergänzung zu den erneuerbaren Energien dienen und immer dann einspringen, wenn der Strombedarf durch Wind- und Solarenergie nicht gedeckt werden kann. Im Rahmen einer "nationalen Kraftwerksstrategie" plante Habeck den Ausbau in verschiedenen Stufen, wie er in einer Pressemitteilung vom 1.8.2023 erklärte. Wörtlich heißt es dort:
Insgesamt sollten die von Habeck geplanten Kraftwerke also eine Leistung von 23,8 Gigawatt erbringen, wobei als Brenngas mittel- und langfristig vor allem Wasserstoff eingesetzt werden sollte. Auf Erdgas wollte man spätestens 2035 verzichten.
Dieser Plan sorgte jedoch für Diskussionen innerhalb der Ampel. Finanzminister Christian Lindner (FDP) bemängelte die hohen Kosten, die laut Schätzungen der Energiebranche etwa 40 Milliarden Euro betragen hätten und zu einem großen Teil über staatliche Förderungen aufgebracht werden sollten. So einigte sich die Ampel-Regierung im Februar 2024 auf einen Kompromiss und kürzte die von Habeck ursprünglich geplante Kraftwerkskapazität zunächst um mehr als die Hälfte – auf zehn Gigawatt. In einem entsprechenden Gesetzesvorhaben, auf das sich die Bundesregierung im Juli 2024 einigte, war schließlich eine geplante Kapazität von 12,5 Gigawatt festgeschrieben. Wie sich die Leistung im Einzelnen zusammensetzen sollte, ist hier nachzulesen.
Die ersten Ausschreibungen für die neuen Kraftwerke sollten Ende 2024 / Anfang 2025 beginnen. Doch das Vorhaben scheiterte. Nach dem Bruch der Ampel-Koalition im November 2024 gelang es der Minderheitsregierung aus SPD und Grünen nicht, die erforderlichen Mehrheiten im Bundestag zu organisieren.
Die neue Regierung aus Union und SPD formuliert in ihrem Koalitionsvertrag das Ziel, bis 2030 eine Gaskraftwerksleistung von "bis zu 20 Gigawatt" zuzubauen. Habecks Nachfolgerin im Bundeswirtschaftsministerium, Katherina Reiche (CDU), betonte dieses Vorhaben zuletzt auf dem Ludwig-Erhard-Gipfel am Tegernsee. "Wir brauchen flexible Gaskraftwerke, die dann Strom liefern, wenn der Wind nicht weht und die Sonne nicht scheint", so Reiche. "Und das brauchen wir schnell." Es sei daher wichtig, "dass wir ganz schnell in die Ausschreibung von mindestens 20 Gigawatt Gaskraftwerken gehen, um die Versorgungssicherheit in unserem Land hochzuhalten". Manche Beobachter zeigten sich irritiert von Reiches Vorstoß, da ihre Formulierung "mindestens 20 Gigawatt" dem Koalitionsvertrag widerspricht, wo von "bis zu 20 Gigawatt" die Rede ist. Ein Sprecher des Wirtschaftsministeriums teilte später gegenüber den Kollegen von "Table.Briefings" mit, er könne sich den Widerspruch nicht erklären. "Wir werden 20 Gigawatt ausschreiben, wie es im Koalitionsvertrag steht", stellte er klar. Ob Schwarz-Rot dabei vorwiegend auf Erdgas oder – wie die Ampel-Koalition – perspektivisch auch auf Wasserstoff setzen will, ist bislang unklar. Wirtschaftsministerin Reiche kündigte bisher lediglich an, sie wolle "langfristige Gaslieferverträge" abschließen. Kritiker bemängeln dies im Hinblick auf den Klimaschutz, manche befürchten auch eine zunehmende Abhängigkeit von anderen Staaten.
Die SPD-Bundestagsabgeordnete Nina Scheer, die das Klima- und Energiekapitel des Koalitionsvertrags mitverhandelt hat, gibt indes zu bedenken, dass die Menge der auszuschreibenden Gaskraftwerke gut begründet sein müsse. Zuerst müssten alle möglichen Alternativen zu neuen Gaskraftwerken geprüft werden, ehe man das vereinbarte Maximum von 20 Gigawatt ausschöpft. "Die Formulierung 'bis zu' unter den Teppich zu kehren, wäre ein Bruch des Koalitionsvertrags", betonte Scheer.
Fazit: Armin Laschet (CDU) sagte in der Sendung, die neue Bundesregierung wolle neue Gaskraftwerke mit einer Leistung von insgesamt 25 Gigawatt bauen. Damit, so Laschet, führe Schwarz-Rot die Strategie des früheren Wirtschaftsministers Robert Habeck fort. Franziska Brantner (B’90/Grüne) entgegnete, in einem Plan der Ampel seien lediglich zehn Gigawatt vorgesehen gewesen. Wie unsere Recherche zeigt, machte das Vorhaben der Ampel eine komplexe Entwicklung durch. Zunächst plante Habeck in einem ersten Aufschlag den schrittweisen Zubau von insgesamt 23,8 Gigawatt. Nach intensiven Verhandlungen verringerte die Ampel-Regierung dieses Ziel jedoch. Man einigte sich zunächst auf zehn und schließlich auf 12,5 Gigawatt. Das Vorhaben scheiterte jedoch in Folge des Koalitionsbruchs im November 2024.
Anders als Laschet in der Sendung sagte, will die neue Regierung nicht 25 Gigawatt zubauen, sondern laut Koalitionsvertrag maximal 20 Gigawatt. Das entspricht ungefähr der Größenordnung, die Robert Habeck in seinem ursprünglichen Plan anpeilte. Insofern hat Laschet Recht, wenn er sagt, dass die neue Regierung in diesem Punkt an Habeck anknüpft. Gleichzeitig ist festzustellen, dass die Kraftwerksleistung, auf die sich die Ampel in weiteren Beratungen einigte, mit 12,5 Gigawatt deutlich niedriger war. Ob Schwarz-Rot bei den Kraftwerken vorwiegend auf Erdgas oder – wie Habeck und die Ampel-Koalition – perspektivisch auch auf Wasserstoff setzen will, ist bislang unklar.
Stand: 16.05.2025
Autor: Tim Berressem