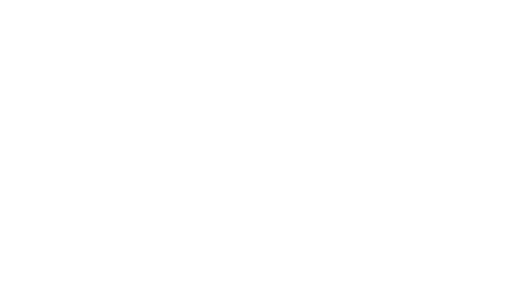Faktencheck zu "maischberger"
Sendung vom 30.06.2025
Faktencheck

Bei Maischberger wird engagiert diskutiert, Argumente werden ausgetauscht, es wird auch schon mal emotional und manchmal bleibt am Ende keine Zeit, um alles zu klären. Wenn Fragen offen bleiben, Aussagen nicht eindeutig waren oder einfach weitere Informationen hilfreich sein könnten, schauen wir nach der Sendung noch einmal drauf – hier in unserem Faktencheck.
Und das schauen wir uns an:
- Hält eine Mehrheit der Deutschen die Meinungsfreiheit für eingeschränkt?
Hält eine Mehrheit der Deutschen die Meinungsfreiheit für eingeschränkt?
Der neue Kulturstaatsminister im Kabinett von Friedrich Merz, Wolfram Weimer, und die Bundestagsabgeordnete Katrin Göring-Eckardt (B’90/Grüne) diskutierten in der Sendung u.a. über den Zustand der Meinungsfreiheit in Deutschland. Weimer zitierte in diesem Zusammenhang eine Umfrage, wonach nur noch 40 Prozent der Deutschen das Gefühl hätten, ihre Meinung hierzulande frei äußern zu können.
Weimer: "Wir wissen aus Umfragen, dass nur noch 40 Prozent der Deutschen der Meinung sind, du kannst in Deutschland frei deine Meinung sagen, ohne irgendwelche Nachteile zu erwarten."
Göring-Eckardt: "Und durch Ihre –"
Weimer: "Nein. Bevor ich im Amt war, war das schon so."
Göring-Eckardt: "Ja, ich weiß."
Weimer: "Und dieser Befund ist eigentlich für uns alarmierend. Als Medienschaffende alarmierend, als Politiker auch. Wie kommt es eigentlich, dass eine Mehrheit der Deutschen das Gefühl hat, in Deutschland kannst du nicht mehr so offen sagen, was du denkst, du musst da aufpassen? Das ist für die politische Kultur des Landes ein gravierendes Problem. Denn noch in den Neunzigerjahren war es so, da haben 95 Prozent der Deutschen gesagt, natürlich kannst du alles sagen, was du denkst."
(…)
Göring-Eckardt: "Wenn man mit Leuten darüber redet, ich habe das getan, im letzten Jahr habe ich –"
Maischberger: "Auch auf den Sommerfesten, die Herr Weimer so nennt?"
Göring-Eckardt: "Auch auf den Sommerfesten und an ganz vielen anderen Stellen. Und ich habe einzeln mit Leuten geredet, manchmal über Stunden. Und ganz am Schluss haben sie immer gesagt, natürlich kann ich sagen, was ich sagen will. Aber ich habe eben Sorge, dass ich Widerspruch bekomme. Und das ist doch das, was wir schützen müssen. Das ist unsere Demokratie, dass man auch Widerspruch aushalten muss. Und zwar egal, von welcher Seite man kommt."
Stimmt das? Hält eine Mehrheit der Deutschen die Meinungsfreiheit für eingeschränkt?
Tatsächlich sorgte eine entsprechende Umfrage des Instituts für Demoskopie Allensbach im Dezember 2023 für Schlagzeilen. Der Befund: Immer weniger Menschen in Deutschland haben das Gefühl, ihre politische Meinung frei äußern zu können. Konkret hatten nur 40 Prozent der Befragten angegeben, hierzulande frei reden zu können – der schlechteste Wert seit Beginn der Befragungen im Jahr 1953. 44 Prozent waren hingegen der Ansicht, dass sie mit Meinungsäußerungen vorsichtig sein müssen.
Wie Wolfram Weimer in der Sendung richtig sagte, hat die sogenannte "gefühlte Meinungsfreiheit" seit den Neunzigerjahren stetig abgenommen. Der von ihm genannte Rekordwert von 95 Prozent wurde aber auch in der Zeit nach dem Mauerfall nicht erreicht. 1990 lag der Anteil der Menschen, die das Gefühl hatten, frei reden zu können, bei 78 Prozent. Bis 2017 sank dieser Wert allmählich auf 63 Prozent. In der letzten Amtszeit von Bundeskanzlerin Angela Merkel verzeichneten die Allensbacher Demoskopen dann einen drastischen Absturz: Im Jahr 2021, Merkels letztem Regierungsjahr, lag die "gefühlte Meinungsfreiheit" nur noch bei 45 Prozent. Der Anteil derer, die in der Umfrage angaben, man müsse mit politischen Meinungsäußerungen besser vorsichtig sein, war mit 44 Prozent fast genau so groß. Als wesentlichen Einflussfaktor für diese Entwicklung sehen Experten vor allem die Corona-Pandemie, deren Hochphase in genau diese Zeit fiel.
2023 vertrat dann erstmals eine Mehrheit der Befragten die Ansicht, man müsse in Deutschland mit Meinungsäußerungen vorsichtig sein (44 Prozent, siehe oben). Politisch war diese Zeit besonders geprägt von den Debatten rund um den russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine.
Aktuell scheint sich jedoch eine leichte Trendwende abzuzeichnen. So zeigen die Zahlen für das Jahr 2024, dass wieder mehr Menschen von der "gefühlten Meinungsfreiheit" überzeugt sind (47 Prozent).
Juristisch steht die Meinungsfreiheit in Deutschland unter sehr hohem Schutz. Sie ist in Artikel 5 des Grundgesetzes verankert und gehört zu den Grundrechten, die nicht durch Verfassungsänderungen angetastet werden dürfen. Demnach darf in Deutschland jeder seine Meinung in Wort, Schrift und Bild frei äußern und verbreiten. Dazu zählt auch die Pressefreiheit sowie die Freiheit von Kunst und Wissenschaft. Doch auch hier gibt es Leitplanken: So stößt die Meinungsfreiheit dort an ihre Grenzen, wo sie mit anderen Rechten und Gesetzen kollidiert. Einschränkungen ergeben sich u.a. aus den Persönlichkeitsrechten, dem Jugendschutz und dem Recht der persönlichen Ehre. Beleidigungen, Verleumdungen sowie rassistische, antisemitische und verfassungsfeindliche Aussagen sind strafbar und nicht von der Meinungsfreiheit gedeckt.
Um den juristischen Aspekt geht es in der Allensbach-Umfrage aber ausdrücklich nicht. Vielmehr fragen die Demoskopen nach der subjektiven Einschätzung der Probanden. So kann es sein, dass Befragte sich subjektiv in ihrer Meinungsfreiheit eingeschränkt fühlen (etwa durch Kommentare, die sie in den sozialen Medien erhalten), auch wenn dies objektiv-juristisch nicht der Fall ist.
Experten wie der Mannheimer Politikwissenschaftler Richard Traunmüller betonen deshalb, dass auch kritische Kommentare Teil der Meinungsfreiheit sind. "Meinungsfreiheit ist eine große Zumutung", erklärte Traunmüller den Kollegen von MDR Wissen. "Das muss man sich klarmachen. Man muss tolerieren, dass es Leute gibt, die Ansichten haben, die man nicht teilt und die man vielleicht sogar gefährlich findet. Und auf der anderen Seite müssen die Leute auch kritikfähig sein und Gegenwind für ihre Ansichten aushalten können. Das sind Sachen, die die Demokratie braucht", so der Politikwissenschaftler. Gleichzeitig warnt er vor den Folgen, die das subjektive Gefühl der Freiheitseinschränkung auf lange Sicht haben kann. Der Gedanke: Wenn viele Menschen glauben, dass der Meinungskorridor immer enger wird, dann könnten sie sich dementsprechend verhalten und im Extremfall ihre eigene Meinung zensieren. Und wenn der freie Meinungsaustausch nicht mehr gewährleistet sei, könne die demokratische Partizipation leiden. Traunmüller plädiert deshalb für eine lebendige Streitkultur, die gegenseitige Meinungen und intensive Debatten zulässt und fördert.
Fazit: In der Diskussion über den Zustand der Meinungsfreiheit in Deutschland verwies Kulturstaatsminister Wolfram Weimer auf eine Umfrage, wonach nur noch 40 Prozent der Deutschen das Gefühl hätten, ihre Meinung hierzulande frei äußern zu können. Tatsächlich sorgte eine solche Erhebung des Allensbach-Instituts im Jahr 2023 für Aufsehen. 44 Prozent waren demnach der Ansicht, dass sie mit Meinungsäußerungen vorsichtig sein müssen – ein Negativrekord. Aktuelle Zahlen aus dem Jahr 2024 deuten jedoch auf eine leichte Trendwende hin: So zeigten sich wieder mehr Menschen (47 Prozent) von der "gefühlten Meinungsfreiheit" überzeugt. Juristisch steht die Meinungsfreiheit in Deutschland unter sehr hohem Schutz. Sie gehört zu den nicht veränderbaren Grundrechten der Verfassung. Um den juristischen Aspekt geht es in der Allensbach-Umfrage aber ausdrücklich nicht, sondern um die subjektive Einschätzung der Probanden.
Stand: 01.07.2025
Autor: Tim Berressem