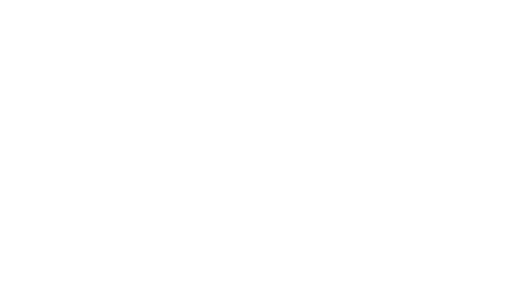Faktencheck zu "maischberger"
Sendung vom 01.07.2025
Faktencheck

Bei Maischberger wird engagiert diskutiert, Argumente werden ausgetauscht, es wird auch schon mal emotional und manchmal bleibt am Ende keine Zeit, um alles zu klären. Wenn Fragen offen bleiben, Aussagen nicht eindeutig waren oder einfach weitere Informationen hilfreich sein könnten, schauen wir nach der Sendung noch einmal drauf – hier in unserem Faktencheck.
Und das schauen wir uns an:
- Was fordern die Regierungschefinnen von Italien und Dänemark zur Erneuerung der europäischen Flüchtlingspolitik?
Was fordern die Regierungschefinnen von Italien und Dänemark zur Erneuerung der europäischen Flüchtlingspolitik?
Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) äußerte sich in der Sendung u.a. zu den Herausforderungen der europäischen Flüchtlingspolitik. Dabei ging es auch um eine neue Initiative, die von Giorgia Meloni und Mette Frederiksen angeführt wird. Was die beiden Regierungschefinnen genau fordern, schauen wir uns hier noch einmal näher an.
Maischberger: "Wäre es nicht ehrlicher, das zu sagen, was z.B. jemand wie Jens Spahn gesagt hat, lasst uns an das Asylrecht ran? Oder wie es Frau Meloni und Frau Frederiksen aus Dänemark sagen, lasst uns an die Europäische Flüchtlingskonvention ran und an die Gerichte, die das entscheiden? Dann hätten Sie tatsächlich einen großen Hebel, statt dass Sie jetzt sozusagen an den Binnengrenzen den kleinen haben."
Merz: "Also, Giorgia Meloni und Mette Frederiksen zusammen mit Dick Schoof, dem niederländischen Ministerpräsidenten, haben einen Vorschlag gemacht, die Europäische Menschenrechtskonvention zu ändern. Nicht die Flüchtlingskonvention."
Maischberger: "Die ist Teil davon."
Merz: "Nein, das ist nicht dasselbe. Es sind zwei völlig verschiedene Dinge. Das eine ist eine Konvention des Europarates, hat mit der Europäischen Union nichts zu tun. Das andere ist das europäische Flüchtlingsrecht und die europäische Asylrichtlinie. So, wir haben in Europa, in der Europäischen Union nur die Möglichkeit, an die europäischen Regeln der Europäischen Union ranzugehen. Das tun wir. Da gibt es jetzt eine erste Entscheidungsrunde, die ist fast abgeschlossen. Es gibt eine Initiative einiger Länder in Europa, ich habe mir das am letzten Donnerstag in Brüssel auch mit angehört, ich bin hingegangen zu dieser Einladung, habe sie wahrgenommen, um das auch kennenzulernen, was dort geplant wird. Und in diesem Zusammenhang ist auch über die Europäische Menschenrechtskonvention gesprochen worden. Dem habe ich mich nicht angeschlossen, weil ich es auch noch nicht endgültig beurteilen kann."
Hintergrund: Was fordern die Regierungschefinnen von Italien und Dänemark zur Erneuerung der europäischen Flüchtlingspolitik?
Am 22. Mai 2025 richteten sich die Regierungschefinnen von Italien und Dänemark, Giorgia Meloni und Mette Frederiksen, mit einem Brief an die Öffentlichkeit, in dem sie dazu auffordern, die Auslegung der Europäischen Menschenrechtskonvention (EMRK) im Kontext der Migrationspolitik neu zu überdenken. Die Regierungschefs von Polen, Belgien, Österreich, Estland, Lettland und der Tschechischen Republik sowie der Präsident Litauens haben den Brief ebenfalls unterzeichnet.
Menschenrechtskonvention: Meloni und Frederiksen sehen Reformbedarf
Im Kern geht es dabei um die Abschiebung straffälliger Ausländer, die in der Vergangenheit häufig durch die Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte (EGMR) verhindert worden sei. Auf diese Weise würden die Richter zunehmend nationale Handlungsspielräume einschränken. In dem offenen Brief bekennen sich die unterzeichnenden Staatschefs klar zu europäischen Werten, der Menschenwürde und internationalen Institutionen wie der EU, den UN und der NATO. Gleichzeitig sehen sie großen Reformbedarf. Die Welt habe sich seit Entstehung der EMRK im Jahr 1950 grundlegend verändert, heißt es in dem Brief. Die illegale Einwanderung nach Europa sei "signifikant angestiegen" und es gebe Migranten, die "sich in Parallelgesellschaften isolieren und sich von unseren Grundwerten der Gleichheit, Demokratie distanzieren". Deshalb, so die weitere Argumentation, müsse der Schutz der Bevölkerung und das Sicherheitsbedürfnis der Mehrheit Vorrang vor individuellen Rechten haben, die die Menschenrechtskonvention bislang auch Migranten garantiert, die im Ankunftsland straffällig geworden sind.
Dies ist in Artikel 3 der EMRK festgeschrieben. Demnach dürfen auch schwere Straftäter nicht abgeschoben werden, wenn ihnen im Heimatstaat eine unmenschliche Behandlung droht, z.B. durch Folter oder die Todesstrafe. Diesen Anspruch hat der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte (EGMR) in der Vergangenheit immer wieder bekräftigt. So verhinderten die Straßburger Richter z.B. im Jahr 1996 die Abschiebung des indischen Staatsbürgers Karamjit Singh Chahal aus dem Vereinigten Königreich, obwohl er von den britischen Behörden wegen seiner Verbindungen zur Sikh-Separatistenbewegung als eine Bedrohung für die nationale Sicherheit eingestuft worden war. Der EGMR befand, dass im Fall von Chahal eine erhebliche Gefahr bestand, dass er in Indien gefoltert oder anderweitig misshandelt werden würde. Dies sei mit der EMRK nicht vereinbar, urteilten die Richter. Artikel 3 stelle ein absolutes Verbot dar und könne nicht durch Erwägungen der nationalen Sicherheit oder der Terrorismusbekämpfung eingeschränkt werden. Die Unterzeichner des offenen Briefs warnen nun vor einer zu engen Interpretation des Artikel 3.
"Beispielloser Angriff": Offener Brief erntet Kritik
Kritiker des offenen Briefs werfen den beteiligten Regierungschefs indes vor, die Autorität des Gerichtshofs zu untergraben. Alain Berset, Generalsekretär des Europarats, betonte, der EGMR habe in den vergangenen 75 Jahren "als fester Kompass gedient, der die Rechtsstaatlichkeit aufrechterhält und die Rechte des Einzelnen innerhalb des Systems der gegenseitigen Kontrolle, das unsere Staaten gemeinsam aufgebaut haben, schützt." Der Fraktionschef der belgischen Sozialdemokraten, Pierre-Yves Dermagne, schrieb, die Initiative von Meloni und Frederiksen stelle "einen beispiellosen Angriff auf eines der höchsten europäischen Gerichte dar, und noch dazu auf dasjenige, das über den Schutz unserer Grundfreiheiten wacht." Die Menschenrechtskonvention sei "ein Leuchtturm, eine wesentliche Orientierungshilfe in einer Zeit, in der die extreme Rechte die Menschenrechte infrage stellt."
Wie Friedrich Merz in der Sendung richtig sagte, haben die EU-Mitglieder keinen Einfluss auf die Ausgestaltung der Europäischen Menschenrechtskonvention. Änderungen können nur vom Europarat vorgenommen werden. Dieser setzt sich aus insgesamt 46 Staaten zusammen und erarbeitete die Konvention im Jahr 1950. Der Europarat ist institutionell nicht mit der Europäischen Union verbunden. Er ist daher auch nicht zu verwechseln mit den EU-Institutionen Europäischer Rat (Organ der Staats- und Regierungschefs) und Rat der Europäischen Union (Ministerrat). Während der Europarat für den grundsätzlichen Schutz von Menschenrechten, Demokratie und Rechtsstaatlichkeit zuständig ist, steht bei den EU-Institutionen die konkrete wirtschaftliche und politische Zusammenarbeit der Mitgliedstaaten im Vordergrund.
Der offene Brief von Meloni und Frederiksen ist also erst einmal nur der Anstoß einer Debatte darüber, inwiefern die europäische Rechtsprechung der gegenwärtigen Migrationslage in den verschiedenen Staaten angemessen ist.
EU kann alleine weder Menschenrechts- noch Flüchtlingskonvention verändern
Auch die Genfer Flüchtlingskonvention (GFK), die grundlegend ist für die Asylpolitik in Europa, kann nicht ohne Weiteres durch die EU verändert werden. Schließlich gilt sie nicht nur in Europa, sondern umfasst insgesamt 149 Staaten auf der ganzen Welt. Eine Änderung des Regelwerks könnten nur alle Vertragsstaaten gemeinsam herbeiführen, was politisch sehr unwahrscheinlich ist. Folglich kann die EU zwar ihre Flüchtlingspolitik verschärfen, diese muss sich aber weiterhin in den Grenzen der GFK bewegen.
Um über mögliche Verschärfungen zu beraten, trafen sich zahlreiche Mitgliedstaaten am Rande des EU-Gipfels, der Ende Juni in Brüssel stattfand. Diskutiert wurde etwa über die Einrichtung von Rückführungszentren in Drittländern. Auch wollen die beteiligten Regierungschefs mehr separate Abkommen mit Herkunfts- und Transitländern schließen. Seit Oktober 2024 hat Giorgia Meloni bereits mehrfach zu solchen dezidiert migrationspolitischen Beratungen eingeladen. Seitdem ist die Zahl der teilnehmenden Staaten stetig gewachsen. Mit Bundeskanzler Merz war nun erstmals auch die deutsche Regierung beteiligt. Konkrete Ergebnisse sind bislang noch nicht bekannt.
Fazit: Die Regierungschefinnen von Italien und Dänemark, Giorgia Meloni und Mette Frederiksen, riefen kürzlich in einem offenen Brief dazu auf, die Auslegung der Europäischen Menschenrechtskonvention (EMRK) im Kontext der Migrationspolitik neu zu überdenken. Konkret bezieht sich ihre Forderung auf straffällige Ausländer, die laut Artikel 3 EMRK vor einer Abschiebung geschützt sind, wenn ihnen im Heimatland eine unmenschliche Behandlung droht. Die insgesamt neun Unterzeichner des Briefs kritisieren, dass der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte diesen Artikel häufig zu eng interpretiere. Da die EU-Mitglieder selbst jedoch keinen Einfluss auf die Ausgestaltung und rechtliche Auslegung der Konvention haben, ist der Brief zunächst nur als Debattenanstoß zu verstehen.
Stand: 02.07.2025
Autor: Tim Berressem