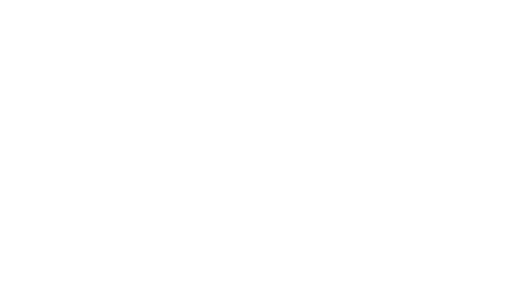Faktencheck zu "maischberger"
Sendung vom 14.07.2025
Faktencheck

Bei Maischberger wird engagiert diskutiert, Argumente werden ausgetauscht, es wird auch schon mal emotional und manchmal bleibt am Ende keine Zeit, um alles zu klären. Wenn Fragen offen bleiben, Aussagen nicht eindeutig waren oder einfach weitere Informationen hilfreich sein könnten, schauen wir nach der Sendung noch einmal drauf – hier in unserem Faktencheck.
Und das schauen wir uns an:
- Würde eine flächendeckende Digitalisierung des Bahnnetzes zu einer höheren Pünktlichkeit beitragen?
Würde eine flächendeckende Digitalisierung des Bahnnetzes zu einer höheren Pünktlichkeit beitragen?
Der schleswig-holsteinische Wirtschaftsminister Claus Ruhe Madsen (CDU) äußerte sich in der Sendung u.a. zu den strukturellen Problemen des deutschen Bahnnetzes. Er bemängelte, dass das Schienensystem hierzulande noch immer weitgehend analog sei, was zu häufigen Verspätungen führe. Die Hintergründe schauen wir uns hier genauer an.
Maischberger: "Meine Prognose als Verkehrsminister, wann die Bahn wieder pünktlich kommt…"
Madsen: "Das sind aber auch keine leichten Vervollständigungssätze. Das wird nie passieren. Und das ist auch ganz leicht zu erklären."
Maischberger: "Wie, das wird nie passieren?"
Madsen: "Ja, so lange wie wir unsere Schiene auf Verschleiß gefahren haben – und ich erkläre Ihnen mal kurz was: Deutschlands Schiene ist analog. Wenn Sie sich Berlin vorstellen, eine Ampel, eine weitere Ampel, dann kann zwischen den beiden Ampeln nur ein Auto stehen. Es ist [rot], das Auto wartet, es ist grün, das Auto fährt weg, es wird wieder rot, das nächste darf hinterherfahren. Das ist das Schienennetzsystem von Deutschland. Zwischen den Ampeln sind 15 Kilometer. Das heißt, auf 15 Kilometern kann nur ein Zug fahren. (…) Ich war übrigens in Japan, mit dem Schnellzug."
Maischberger: "Ja, der Shinkansen."
Madsen: "Ja, mit dem Shinkansen. Der hat im Jahr sieben Minuten Verspätung, insgesamt."
Maischberger: "Ich glaube, das ist noch übertrieben, ja."
Madsen: "Hat man mir zumindest erzählt. Und ich war mit Daniel Günther und einigen weiteren Schleswig-Holsteinern in diesem Zug. Wir kamen sechs Minuten zu spät an, und Daniel Günther sagte, es müssen nur genug Deutsche im Zug sitzen, dann kommt er auch zu spät. Also, von daher. Ich glaube, das ist aber auch nicht zu vergleichen. Da fährt nur ein Zug auf genau dieser Schiene, da fährt nicht noch so eine Bimmelbahn."
Hintergrund: Würde eine flächendeckende Digitalisierung des Bahnnetzes zu einer höheren Pünktlichkeit beitragen?
Wie die Deutsche Bahn zuletzt mitteilte, war im Jahr 2024 mehr als jeder dritte Fernzug hierzulande unpünktlich. 37,5 Prozent der Haltestellen wurden demnach mit einer Verspätung von mehr als sechs Minuten erreicht. Damit war die Deutsche Bahn so unpünktlich unterwegs wie seit über 20 Jahren nicht. Wesentlicher Grund sei die veraltete und störanfällige sowie überlastete Infrastruktur, heißt es seitens des Unternehmens.
Deutsches Schienennetz noch weitgehend analog
Ein Großteil der Verspätungen entsteht, wenn ein Zug auf offener Strecke stehen bleiben muss, um Platz für einen anderen Zug zu machen oder den erforderlichen Abstand zu einer vorausfahrenden Bahn einzuhalten. Um diese Wartezeiten in Zukunft zu minimieren, fordern Verkehrspolitiker schon seit Jahren eine flächendeckende Digitalisierung des Schienennetzes. Denn wie unser Studiogast Claus Ruhe Madsen bereits in der Sendung sagte, funktioniert die Koordination des Zugverkehrs in Deutschland bislang noch größtenteils analog. Das heißt: Die Züge richten sich auf ihrer Fahrt nach den Ampeln, die entlang der Strecke aufgestellt sind. Diese zeigen, ob der nächste Streckenabschnitt frei ist. Wenn die Strecke bereits von einem anderen Zug belegt ist, muss gewartet werden. Gerade auf Fernstrecken kommt es deshalb regelmäßig zu Verzögerungen, die sich kaskadenartig auch auf die nachfolgenden Züge auswirken können.
Durch die Digitalisierung hingegen soll der Zugverkehr deutlich flüssiger werden. Die Idee: Über ein Display im Führerstand sollen die Zugführer in Echtzeit darüber informiert werden, wie lange die Strecke vor dem Zug frei ist und wie schnell gerade gefahren werden darf. Die starre Unterteilung in Streckenabschnitte, die jeweils per Ampelschaltung freigehalten werden, würde somit der Vergangenheit angehören. Die Abstände könnten verdichtet werden, mehr Züge könnten hintereinander auf den Strecken fahren. Von 20 bis 35 Prozent mehr Kapazität ist bei der Bahn die Rede – und zwar ohne neue Strecken bauen zu müssen.
Dass aktuell ein Abstand von 15 Kilometern zwischen zwei Fernzügen eingehalten werden muss, wie Claus Ruhe Madsen in der Sendung sagte, stimmt nicht. Wie groß der Abstand tatsächlich sein muss, hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Geschwindigkeit der Züge oder der Beschaffenheit der jeweiligen Strecke. So kann etwa der Mindestabstand zweier ICE-Züge je nach Streckenbedingungen zwischen 500 und 2.000 Metern liegen.
Digitalisierung verläuft schleppend
Wann Deutschland sein Schienennetz vollständig digitalisiert haben wird, ist derzeit unklar. Bereits 2018 beschloss die damalige schwarz-rote Bundesregierung das Projekt "Digitale Schiene Deutschland". In diesem Rahmen plante man, das gesamte bundeseigene Schienennetz bis zum Jahr 2040 mit dem Europäischen Zugsicherungs- und Zugsteuerungssystem "European Train Control System" (ETCS) und digitalen Stellwerken (DSTW) auszurüsten, um einen flüssigeren Zugbetrieb – wie oben beschrieben – zu ermöglichen. Die Umsetzung verläuft jedoch schleppend. Aus einem Gutachten des Bundesrechnungshofs geht hervor, dass bis Februar 2023 lediglich 520 von insgesamt 33.000 Schienenkilometern mit ETCS ausgestattet wurden. Behält man dieses Tempo bei, wäre das Ziel bis 2040 nicht zu erreichen. Gleichzeitig häufen sich die Berichte über technische Störungen bei der Inbetriebnahme des Systems. Immer wieder müssen Züge um ETCS-Strecken herumgeleitet werden, was nur zu weiteren Verspätungen führt. Anders als z.B. die Schweiz oder Österreich, wo das System schon seit längerer Zeit genutzt wird, verwendet Deutschland die neueste ETCS-Version, die aktuell noch nicht vollständig ausgereift ist. Vor diesem Hintergrund entschied die Bahn kürzlich, bei der Sanierung der wichtigen Strecke Berlin – Hamburg vorerst auf eine Umrüstung zum digitalen Leitsystem zu verzichten.
Die neue Bundesregierung aus Union und SPD nennt bislang keine konkreten Ziele für die Digitalisierung des Schienennetzes. Im Koalitionsvertrag heißt es lediglich: "Investitionen in die Digitalisierung werden mit einem Schwerpunkt auf digitale Stellwerke und eine flächendeckende ETCS-Ausrüstung priorisiert, die fahrzeugseitige Ausstattung haben wir im Blick." Bundesverkehrsminister Patrick Schnieder (CDU) kündigte Ende Juni an, das Vorhaben vollständig über das Sondervermögen Infrastruktur und Klimaneutralität (SVIK) finanzieren zu wollen. Knapp 107 Milliarden Euro sollen bis 2029 in die Schiene fließen. Neben der Digitalisierung umfasst dieser Betrag aber auch die Sanierungen des Bestandsnetzes und baufälliger Brücken. Ein konkretes Zieldatum für die Digitalisierung nannte der Minister nicht.
Kann Japan als Vorbild dienen?
In Japan, dem Land, das Claus Ruhe Madsen in der Sendung als Vorbild für das deutsche Schienennetz nannte, erfolgt die Koordination der Züge bereits größtenteils digital. Nur auf weniger frequentierten Strecken erfolgt die Signalstellung dort noch analog. Weltweit bewundert werden die japanischen Züge für ihre Pünktlichkeit, insbesondere der Hochgeschwindigkeitszug Shinkansen, der als einer der pünktlichsten Züge überhaupt gilt. Im Jahr 2024 betrug dessen durchschnittliche Verspätung je nach Quelle zwischen einer und zwei Minuten. Zum Vergleich: Bei uns verspäteten sich die Fernzüge ICE und IC im Schnitt um 10,3 Minuten.
Der Shinkansen ist jedoch nicht unbedingt repräsentativ für das gesamte japanische Schienennetz. Im Nahverkehr müssen auch die Japaner regelmäßig Geduld aufbringen, besonders zu den Stoßzeiten des Berufsverkehrs.
Das Besondere am Shinkansen: Er fährt auf seiner eigenen Strecke. Anders als die deutschen ICE-Züge muss er sich das Gleis nicht mit langsameren Personen- oder Güterzügen teilen. So kommt es kaum zu Verzögerungen. Vor diesem Hintergrund machte die Deutsche Bahn in der Vergangenheit wiederholt deutlich, dass eine Pünktlichkeit wie in Japan hierzulande unerreichbar sei. "In Deutschland teilen sich Güter-, Regional- und Fernverkehrszüge ein und dasselbe Schienennetz. Dieses Konzept ist nicht auf 99 Prozent Pünktlichkeit ausgelegt", so der für den Personenfernverkehr zuständige Bahn-Vorstand Michael Peterson.
Fazit: Bahn-Kritiker fordern seit Jahren eine flächendeckende Digitalisierung des deutschen Schienennetzes, um Verspätungen in Zukunft zu reduzieren. Durch digitale Steuerungssysteme, die in Echtzeit auf die Verkehrslage reagieren, soll der Zugverkehr flüssiger werden. Wartezeiten auf freier Strecke sollen minimiert, die Abstände zwischen den Zügen verdichtet werden. 2018 stieß die damalige Bundesregierung bereits eine entsprechende Initiative an, die Umsetzung läuft jedoch schleppend. Die neue schwarz-rote Koalition will die Digitalisierung der Schiene künftig mit mehreren Milliarden aus dem Sondervermögen Infrastruktur weiter vorantreiben.
Stand: 15.07.2025
Autor: Tim Berressem