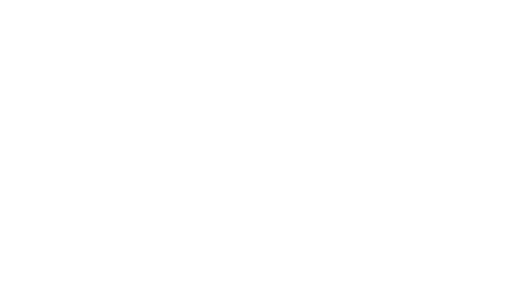Faktencheck zu "maischberger"
Sendung vom 16.09.2025
Faktencheck

Bei Maischberger wird engagiert diskutiert, Argumente werden ausgetauscht, es wird auch schon mal emotional und manchmal bleibt am Ende keine Zeit, um alles zu klären. Wenn Fragen offen bleiben, Aussagen nicht eindeutig waren oder einfach weitere Informationen hilfreich sein könnten, schauen wir nach der Sendung noch einmal drauf – hier in unserem Faktencheck.
Und das schauen wir uns an:
- Welche Rolle spielte die Union bei der Einführung des Bürgergelds?
Welche Rolle spielte die Union bei der Einführung des Bürgergelds?
Der rheinland-pfälzische Ministerpräsident Alexander Schweitzer (SPD) reagierte in der Sendung auf die Kritik am Bürgergeld, die zuletzt immer wieder von Vertretern der Union geäußert wurde. Schweitzer gab zu bedenken, dass die Union seinerzeit selbst an der Einführung des Bürgergelds mitgewirkt habe.
Maischberger: "Markus Söder sagt: 'Gerade das Ruhrgebiet ist ein Alarmsignal für die SPD. Daher muss das unfaire Bürgergeld rasch weg.' Noch so ein Vorschlag. War das Bürgergeld der größte Fehler der SPD?"
Schweitzer: "Mein Problem ist, dass ich mich daran erinnern kann, wer bei diesen Bürgergeld-Verhandlungen mit am Tisch saß."
Maischberger: "Markus Söder?"
Schweitzer: "Er nicht, aber jemand von der CSU, jemand von der CDU in Nordrhein-Westfalen, der heutige Sozialminister. Das ist damals gemeinsam beschlossen worden. Ich finde, es ist so etwas wie eine moderne Geschichtsklitterung, dass erzählt wird, die SPD hätte das Bürgergeld alleine erfunden und umgesetzt. Das wäre gar nicht möglich gewesen, weder im Bundesrat noch im Bundestag. Die CDU, die Union blendet da ihre eigene Rolle jetzt aus. Das finde ich nicht ganz zulässig."
Hintergrund: Welche Rolle spielte die Union bei der Einführung des Bürgergelds?
Das Bürgergeld trat zum 1. Januar 2023 in Kraft und war eines der zentralen Reformvorhaben im Koalitionsvertrag der Ampel-Regierung. Besonders die SPD wollte durch die Einführung einer neuen Grundsicherung für Arbeitsuchende die anhaltenden Debatten über das bisherige Hartz-IV-System beenden. Mit dem Bürgergeld sollte der Fokus verstärkt auf einer nachhaltigen Integration in den Arbeitsmarkt liegen. Die gezielte Aus- und Weiterbildung sollte Vorrang haben vor einer schnellstmöglichen Vermittlung in irgendeinen beliebigen Job, was Kritiker des Hartz-IV-Systems häufig bemängelten. Gleichzeitig brachte das Bürgergeld einige Erleichterungen für die Betroffenen: Höhere Regelsätze, mildere Sanktionen, mehr Kulanz bei Schonvermögen und Wohnungsgröße.
Aus Sicht von SPD und Grünen bietet das Bürgergeld den betroffenen Personen somit mehr Sicherheit in schwierigen Lebenslagen. Union, AfD und die FDP, die selbst Teil der Regierungskoalition war, kritisieren dagegen, dass mit dem Bürgergeld die Anreize gesunken seien, sich eine Arbeit zu suchen.
Kanzler Merz will bei Bürgergeld sparen
Ausdrückliche Kritik kommt auch vom Bundeskanzler: Friedrich Merz (CDU) will die Kosten für das Bürgergeld – derzeit etwa 50 Milliarden Euro pro Jahr – in Zukunft um rund zehn Prozent kürzen. "Das ist ein Betrag, der muss möglich sein. Also wenn wir uns nicht mehr trauen, in einem Transfersystem, das in die falsche Richtung läuft, zehn Prozent einzusparen, dann versagen wir vor dieser Aufgabe", bekräftigte Merz Anfang September gegenüber n-tv. Wenige Tage zuvor, auf dem nordrhein-westfälischen Landesparteitag der Christdemokraten in Bonn, sagte Merz: "Wir können uns dieses System, das wir heute so haben, einfach nicht mehr leisten". Dabei bezog er sich auch auf das Bürgergeld.
Unser Studiogast Alexander Schweitzer (SPD) reagierte in der Sendung auf die Kritik der Union und sagte, CDU und CSU hätten damals selbst an der Einführung des Bürgergelds mitgewirkt.
Diese Aussage muss differenzierter betrachtet werden. Denn bei der ersten Abstimmung im Bundestag am 10. November 2022 votierte die Unions-Fraktion geschlossen gegen den Gesetzentwurf der Ampel. Zwar unterstützten CDU und CSU die geplante Anhebung der Regelsätze, kritisierten jedoch deutlich, dass mit dem Bürgergeld das Prinzip "Fördern und Fordern" nicht ausreichend gewahrt würde.
Union stimmte zunächst gegen Bürgergeld-Entwurf
Trotz der 188 Gegenstimmen der Unions-Fraktion, 70 Nein-Stimmen der AfD sowie 33 Enthaltungen der Linken konnte die Ampel die Abstimmung mit einfacher Mehrheit gewinnen. Am Ziel war man damit aber noch nicht. Denn damit das Bürgergeld in Kraft treten konnte, bedurfte es auch der Zustimmung des Bundesrats. Wie bereits unmittelbar nach der Bundestagsabstimmung angekündigt, enthielten sich fünf der sechs unionsgeführten Länder bei der Abstimmung am 14. November 2022. Auch Baden-Württemberg, das von einer grün-schwarzen Koalition regiert wurde, enthielt sich. Das von der CSU regierte Bayern stimmte mit "Nein". Somit war das Bürgergeld vorerst gestoppt.
Auf Betreiben des damaligen Bundesarbeitsministers Hubertus Heil (SPD) rief die Bundesregierung umgehend den Vermittlungsausschuss an. Ihm gehören 16 Mitglieder des Bundestags und 16 Vertreter des Bundesrats an, die entsprechend den jeweiligen Fraktionsstärken benannt sind und immer dann beraten können, wenn zwischen Bundestag und Bundesrat keine Einigkeit über einen Gesetzentwurf besteht.
Nach erfolgloser Abstimmung im Bundesrat: Union unterstützte Bürgergeld-Kompromiss
Knapp eine Woche nach der gescheiterten Abstimmung im Bundesrat erzielte man schließlich einen Kompromiss. Die sogenannte Karenzzeit, in der die Kosten für die Unterkunft ohne Prüfung der Angemessenheit übernommen werden, wurde auf ein Jahr verkürzt – der Entwurf der Ampel hatte zwei Jahre vorgesehen. Das sogenannte Schonvermögen, also jene finanzielle Reserve, die während der Karenzzeit nicht angetastet wird, wurde von 60.000 Euro auf 40.000 Euro herabgesetzt. Gänzlich entfallen sollte zudem die von der Ampel-Koalition beschlossene sechsmonatige Vertrauenszeit, in der auch bei Pflichtverletzungen, z.B. grundlose Terminversäumnisse, keine Sanktionen in Form von Leistungskürzungen verhängt worden wären.
Kurz darauf wurde das geänderte Bürgergeld-Gesetz mit den erforderlichen Mehrheiten angenommen. Im Bundestag stimmte diesmal neben den Ampel-Fraktionen auch die Unions-Fraktion dafür. Von insgesamt 557 Ja-Stimmen kamen 176 aus den Reihen von CDU und CSU. Auch der Bundesrat stimmte dem Gesetz mehrheitlich zu, und zwar mit den Stimmen aller sechs unionsgeführten Bundesländer, wie in den Protokollen der einzelnen Landesvertretungen nachzulesen ist.
Vertreter der Union zeigten sich damals weitgehend zufrieden mit dem Kompromiss. "Wir haben in den Verhandlungen schwere Systemfehler im Hartz-IV-Update, das ja missverständlich als Bürgergeld bezeichnet wird, also schwere Fehler im Hartz-IV-Update beseitigen können", erklärte der damalige CSU-Landesgruppenvorsitzende Alexander Dobrindt. CDU-Chef Friedrich Merz hatte den Einigungsvorschlag bereits vor der Abstimmung gelobt. Zu seiner Überraschung sei die Ampel-Koalition zu weitgehenden Kompromissen bereit gewesen. "Damit ist das Gesetz, so wie es jetzt in dieser Form vorliegt, aus unserer Sicht zustimmungsfähig", sagte Merz am 22. November 2022, drei Tage vor der finalen Abstimmung im Bundesrat.
Fazit: Tatsächlich stimmte die Union im November 2022 dem Bürgergeld in seiner heutigen Form zu. Den ursprünglichen Gesetzentwurf der Ampel-Regierung lehnte man jedoch ab, weil damit nach Meinung der Union das Prinzip "Fördern und Fordern" nicht ausreichend gewahrt worden wäre. Nachdem das Vorhaben im Bundesrat durch die unionsgeführten Bundesländer zunächst gestoppt wurde, erarbeitete der Vermittlungsausschuss, in dem sowohl die Ampel-Parteien als auch die Union vertreten waren, einen Kompromiss. Die sogenannte Karenzzeit wurde von zwei auf ein Jahr gekürzt, das Schonvermögen senkte man von 60.000 auf 40.000 Euro. Die von der Ampel geplante Vertrauenszeit, in der keine Sanktionen verhängt werden sollten, entfiel vollständig. Der auf diese Weise geänderte Gesetzentwurf erhielt schließlich die notwendigen Mehrheiten in Bundestag und Bundesrat – unter maßgeblicher Zustimmung der Union.
Stand: 17.09.2025
Autor: Tim Berressem