So., 30.07.23 | 23:35 Uhr
Das Erste
Ende der China-Illusion – ein neuer Umgang mit der Supermacht
Was tun, wenn der wichtigste Handelspartner eine diktatorische Militärmacht ist? Sich wenig kümmert um Menschenrechte, Geschäfte macht mit Russland. Kurz: die Spielregeln diktiert? Lang hat Deutschland gezögert, sich seinen China-Illusionen zu stellen. Bis jetzt. Nach langem Ringen hat die Bundesregierung vor kurzem ihre China-Strategie vorgestellt – und Außenministerin Baerbock macht klar: "Für Deutschland bleibt China Partner, Wettbewerber, systemischer Rivale."
Hongkong-Dissidenten unter Druck
Chinas repressives System reicht bis nach Europa: Anfang Juli setzt die Regierung von Hongkong ein Kopfgeld aus auf acht im Ausland lebende Dissidenten. Grund zur Beunruhigung auch für Ray Wong. 2016 organisierte er bei der Regenschirmrevolution Proteste. Jetzt lebt er in Deutschland im Asyl. Er habe Angst um seine Familie, sagt er, die noch in Hongkong lebe: "Ich fürchte, dass sie wegen des Kopfgeldes in Gefahr gerät, weil ich in Deutschland noch immer aktiv bin."

Im Westen hat man die Demokratiebewegung in Hongkong so gut wie vergessen. Nachdem die Briten den Stadtstaat an China übergeben hatten, sollte die Demokratie dort eigentlich fünfzig Jahre lang fortgeführt werden. China hatte andere Pläne. Wong bestätigt: "Bis 2019 hatte Hongkong eine der aktivsten Bürgerschaften Asiens. Jetzt existiert sie nicht mehr."
Wirtschaft versus Menschenrechte
Und der Westen? Sah zu. Wirtschaftsjournalist und China-Korrespondent Felix Lee ist der Ansicht, Deutschland hätte "zumindest verbal vehementer auftreten" müssen: "Vom damaligen deutschen Außenminister Heiko Maas kam so gut wie gar nichts. Es wurde nicht einmal ein Zeichen gesetzt, dass man nicht akzeptiert, wie China da vorgeht."
Auch Janka Oertel, Direktorin des Asien-Programms des European Council on Foreign Relations, hätte hier eine Gelegenheit für den Westen gesehen, klarzumachen, wofür er steht: “Man hätte deutlich machen sollen, welchen Preis man auch bereit ist zu bezahlen – dafür, dass man sich für Werte wie Demokratie, wie Rechtsstaatlichkeit etc. einsetzt. Und man kann ganz klar sagen: Im Falle Hong Kong war man nicht bereit, von westlicher Seite aus diesen Preis zu bezahlen.”
Der Preis für Deutschlands Wirtschaft wäre hoch. Zu hoch. Menschenrechte stehen gegen Wirtschaftsinteressen. Eine Strategie für den Umgang mit China, längst überfällig, hat die Bundesregierung vor ein paar Wochen vorgestellt. Wie beim chinesischen Brettspiel "Go" sind Geduld und Disziplin gefragt. Tugenden, die China meisterhaft beherrscht.
Ein neuer Umgang mit der Supermacht
China habe sich verändert, konstatiert Annalena Baerbock in ihrer Rede zur neuen China-Strategie und sagt, dass sich auch die Chinapolitik der Bundesregierung ändern müsse.

Von einer Loslösung, einer Entkopplung, ist nicht die Rede. Zu eng sind die gegenseitigen wirtschaftlichen Abhängigkeiten. Stattdessen fordert die Regierung, dass die heimische Industrie auch auf Partner in anderen Ländern setzen soll. Den bisherigen Kurs zu ändern wird allerdings nicht einfach, schreibt Janka Oertel in ihrem Buch "Ende der China-Illusion": "Das wird uns vor allem im Bereich der grünen Technologie noch große Kopfschmerzen bereiten. Sind wir bereit, die grüne Transformation zu verschieben, um auf Solarprodukte aus China zu verzichten? Ja oder nein? Was, wenn diese mit Zwangsarbeit hergestellt wurden? Ja oder nein? Wenn unsere Interessen, unsere Ziele im Widerspruch zueinanderstehen, sind das die schwierigen Momente. Und da ist eben dann die Politik gefordert."
Zukunftstechnologie kommt aus China
Beispiel Arnstadt. Vor den Toren der thüringischen Kleinstadt werden seit Januar Batterien für E-Autos hergestellt. Es ist das größte Werk des chinesischen Großkonzerns CATL in Westeuropa. Die deutschen Autobauer sind angewiesen auf die Akkus aus Fernost. In Sachen Zukunftstechnologie hat China Deutschland abgehängt. Gestützt wird das durch Thüringens Ministerpräsident Wolfgang Tiefensee: "Wir transferieren nicht Know-How nach China. Das ist heute gar nicht mehr nötig, so stark wie China ist. Sondern wir holen das Know-How von China nach Deutschland – und entwickeln gemeinsam die Produkte weiter."

Aber kann von Gemeinsamkeit wirklich die Rede sein? Chinas Machtpolitik ist selbstbewusst einseitig: Man profitiert gerne vom Wissen der anderen, während man sich selbst abgrenzt. Den Aufstieg des Landes zur Wirtschaftsmacht hat Felix Lee aus nächster Nähe beobachtet. Sein Vater half Volkswagen beim Aufbau der ersten VW-Werke in China. Das Land denke in anderen Dimensionen: "Wir sprechen hier von zehn, fünfzehn, dreißig Jahren – technologisch, wirtschaftlich, industriell, gesellschaftlich, aber auch politisch, auch weltpolitisch. Und so eine Denke, das fällt uns im Westen natürlich schwer, die wir eigentlich eher in Vier-Jahres-Zyklen denken, nämlich immer bis zur nächsten großen Wahl."
Partner und systemischer Rivale – geht das?
Ende Juni traf Chinas Ministerpräsident Li Qiang Bundeskanzler Scholz in Berlin. Eine gute Gelegenheit, einen neuen Umgang mit dem Rivalen zu demonstrieren. Aber bei der anschließenden Pressekonferenz wurden keine Fragen zugelassen, der Kanzler knickte ein. Auch China-Expertin Janka Oertel bekräftigt: "Mit der Macht tun wir uns durchaus schwer. Wir mögen gerne den Mittelweg, den Kompromiss. Wir wollen nicht so gern die deutsche Macht ausspielen. Dabei ist Deutschland mächtig. Und das bedeutet eben auch, dass man da nicht einknicken darf. Nur das wird verstanden in Peking: Nur wenn man selber aus einer Position der Macht auftritt, wird man dazu kommen, dass man seine Interessen auch durchsetzen kann."
Die neue China-Strategie, die Zusammenarbeit mit einem systematischen Rivalen, mag besser sein als der naive Glaube an "Wandel durch Handel" – diese Illusion, immerhin, ist geplatzt. Aber die Herausforderungen, vor die uns China stellt, die bestehen nach wie vor.
Autorin: Petra Böhm
Stand: 02.08.2023 10:28 Uhr

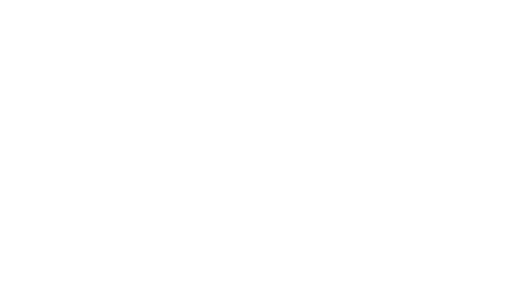


Kommentare