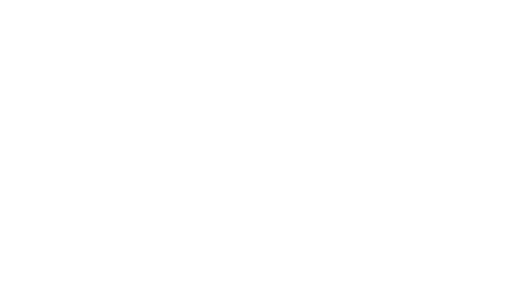Extremisten als Kandidaten? Dilemma für kommunale Wahlausschüsse
Immer mehr kommunale Wahlausschüsse müssen vor Bürgermeister- oder Landratswahlen entscheiden: Sollen sie einen mutmaßlich extremistischen Kandidaten zur Wahl zulassen oder nicht?
Text des Beitrags:
Er will Bürgermeister von Paderborn werden: Marvin Weber, ein Lokalpolitiker der AfD. In Videos auf seiner Facebook-Seite präsentiert er sich als volksnaher Redner, der oft drastische Formulierungen wählt.
Marvin Weber:
„Was wir erleben, ist Kultur- und Staatszersetzung im grünen Unrechtsstaat.”
„Die Deutschen sollen mit der ewigen historischen Zwangsneurose quasi erpresst werden.“
„Es wird alles unter den Teppich gekehrt, was uns Deutschen hier widerfährt an Ungerechtigkeit.”
Auch der nordrhein-westfälische Verfassungsschutz hat ihn im Visier, zu Weber sogar eine eigene Analyse erstellt, mit klarer Einschätzung: Es lägen „tatsächliche Anhaltspunkte” dafür vor, dass Weber „Bestrebungen gegen die freiheitliche demokratische Grundordnung” verfolge. Weber sieht das anders, weist die Vorwürfe zurück. Seine Aussagen seien allesamt durch die Meinungsfreiheit gedeckt.
Und dennoch steht die Frage im Raum: Darf er hauptamtlicher Bürgermeister werden, also ein Staatsdiener?
Wahlausschüsse stecken in einem Dilemma
Darüber mussten im Juli die sieben Mitglieder des Wahlausschusses in Paderborn entscheiden. Mit dabei waren zwei Vertreter ihrer Partei, der Grünen.

Catharina Scherhans, B’90/Grüne, Parteivorsitzende Paderborn:
„Wenn wir in einer wehrhaften Demokratie leben und ein Verfassungsschutz sagt, dieser Kandidat steht nicht auf dem Boden der freiheitlich demokratischen Grundordnung, dann ist es für mich eine Haltungsfrage zu sagen: Dem kann ich nicht zustimmen.”
Denn auch in der Gemeindeordnung steht unmissverständlich: Wählbar sei nur, wer „...jederzeit für die freiheitlich demokratische Grundordnung im Sinne des Grundgesetzes eintritt.”
Und dennoch kam es in Paderborn anders. Der Wahlausschuss ließ den AfD-Mann zusammen mit allen anderen Bewerbern für die Wahl zu - mit fünf zu zwei Stimmen.
Auch Ulrich Koch von der SPD hat dafür gestimmt - wegen juristischer Bedenken. Denn eine rechtliche Sicherheit, ob Marvin Weber tatsächlich ein Verfassungsfeind ist, gibt es nicht. Es gibt nur die Einschätzung des Verfassungsschutzes, die aber noch kein Gericht bewertet hat.
Ulrich Koch, SPD, Mitglied Wahlausschuss Paderborn:
„Uns vor Ort Ehrenamtlern diese Entscheidung zu überlassen - ist er, ist er das nicht - das kann man uns nicht zumuten. Ich bin ja selber auch unwohl, das will ich ja gar nicht abstreiten, aber rein rechtlich habe ich es eben in der Kürze der Zeit, nochmal, nicht für möglich gehalten, da anders zu entscheiden.“
Mehr als 20 ähnliche Fälle bundesweit
Die rechtliche Unsicherheit war am Ende zu groß, nicht nur in Paderborn. Bundesweit stehen kommunale Wahlausschüsse vor der Frage: Wie umgehen mit umstrittenen, mutmaßlich extremistischen Kandidaten?
Allein in den vergangenen fünf Jahren finden wir mehr als 20 Fälle, bei denen es Diskussionen um die Verfassungstreue gab, Kandidaten unterschiedlicher Parteien. In den grün markierten Kommunen wurden sie zur Wahl zugelassen, in rot markierten Orten abgelehnt.
Klaus Ritgen ist Jurist, Referent beim Landkreistag. Er hat sich in einem Gutachten mit dem Thema auseinandergesetzt. Durch das Erstarken der AfD würden die kommunalen Wahlausschüsse in Zukunft immer mehr gefordert.

Klaus Ritgen, Referent Deutscher Landkreistag:
„Sie haben eben die Wahl zwischen Pest und Cholera, um es mal so zu formulieren. Sie können entweder sehenden Auges eine Person, bei der sie Zweifel haben, ob sie die Verfassungstreue mitbringt, zur Wahl zulassen und dann die Möglichkeit in Rechnung stellen müssen, dass die Wahl im Nachgang für ungültig erklärt wird. Oder sie setzen sich dem Vorwurf aus, rein politisch entschieden zu haben und einen Kandidaten nicht zur Wahl zugelassen zu haben, weil sie Angst vor seinen Erfolgsaussichten haben.”
Diskussion um abgelehnten AfD-Kandidaten in Ludwigshafen
Genau darum dreht sich noch immer die Diskussion im rheinland-pfälzischen Ludwigshafen. Hier hat der Wahlausschuss den AfD-Kandidaten ausgeschlossen. Mit sechs zu eins-Stimmen. Es geht um ihn: Joachim Paul.
Seit Jahren gibt es Berichte, die Zweifel säen an seiner Verfassungstreue: Zum Beispiel wegen Kontakten zum rechtsextremen Vordenker Martin Sellner. Weil er einer Burschenschaft angehört, die 2011 eine Art ‘Ariernachweis’ für neue Mitglieder forderte. Und weil er in einem Artikel schrieb: „Remigration statt Unterwerfung”.
Paul selbst hält das alles für unproblematisch. Er sei Demokrat, ein engagierter Politiker, sieht sich als Opfer.

Joachim Paul, AfD, Landtagsabgeordneter Rheinland-Pfalz:
„Es gab ein Zusammenspiel mit der Wahlleiterin, der Oberbürgermeisterin, dem Innenministerium und dem Verfassungsschutz, der ein Inlandsgeheimdienst ist, mit dem Ziel, mich - und die Konkurrenz hat ja auch in dem Wahlausschuss über mich abgestimmt, die SPD-Konkurrenz und CDU-Konkurrenz -, um mich loszuwerden.”
Und Paul wird nicht müde, diese Position in die Öffentlichkeit zu tragen. Wendet sich sogar an die US-Regierung und Elon Musik, ein inszenierter Hilferuf:
Joachim Paul, AfD, Landtagsabgeordneter Rheinland-Pfalz:
„Dear Mr. Vance, dear Mr. Rubio, dear Mr. Musk. My name is Joachim Paul, I’m the candidate of the party Alternative for Germany..... Please help us...”
Und Musk fragt zurück: „Ausgeschlossen von der Wahl ohne tatsächliches Vergehen?”
Oberbürgermeisterin und Innenminister verteidigen Verfahren
Die parteilose Oberbürgermeisterin von Ludwigshafen ist qua Amt Vorsitzende des Wahlausschusses, tritt selbst aber nicht mehr zur Wahl an. Sie verteidigt das Verfahren. Obwohl sie nach der Entscheidung Morddrohungen erhalten habe. Auch der rheinland-pfälzische Innenminister weist die Vorwürfe zurück.

Jutta Steinruck, parteilos, Oberbürgermeisterin Ludwigshafen:
„Plötzlich ist der Wahlausschuss, der jahrzehntelang mündig genug war, Entscheidungen zu treffen, unmündig, unfähig. Wir können doch nicht bei jeder unliebsamen Entscheidung, wenn es eine öffentliche Diskussion gibt, Gewissenentscheidungen von Mitgliedern eines demokratischen Gremiums, und das ist der Wahlausschuss, in Frage stellen.”

Michael Ebling, SPD, Innenminister Rheinland-Pfalz:
„Ich nehme wahr, dass ein Bewerber, der dort ausgeschlossen ist, versucht, sich als Opfer zu stilisieren. Am Ende ist es ein Verfahren, wie es das Gesetz in Rheinland-Pfalz, auch in anderen Bundesländern, kennt. Es ist ein gesetzlich geregeltes Verfahren, und zwei Gerichte haben bestätigt, dass es offensichtlich keinen Fehler gibt.”
In der Tat haben zwei Gerichte in Rheinland-Pfalz geurteilt, dass das Verfahren zu Pauls Ausschluss keine offensichtlichen Fehler aufwies. Ob der Ausschluss aber grundsätzlich richtig war, kann Paul erst nach der Wahl gerichtlich überprüfen lassen. Bekäme er Recht, müsste die Wahl wiederholt werden.
Ludwigshafen, Paderborn: Zwei ähnliche Fälle, in denen die Wahlausschüsse aber unterschiedlich entschieden haben. Zurück bleibt ein rechtliches Dilemma - und der Vorwurf, dass Wahl-Zulassungen undemokratisch abliefen. Gibt es einen Ausweg?
Experte fordert Rechtssicherheit vor dem Wahltermin
Ja, sagt der Verfassungsrechtler Christian Pestalozza. Er fordert, die unabhängige Justiz früher zu beteiligen. Heißt: vor dem Wahltermin.
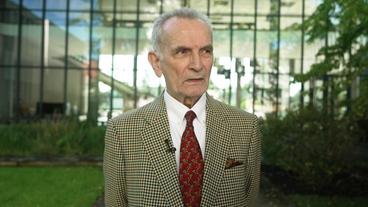
Prof. Christian Pestalozza, Rechtswissenschaftler FU Berlin:
„Der Gesetzgeber müsste das zum Anlass nehmen, sich Gedanken zu machen, ausdrücklich ein nicht nur vorläufiges Verfahren, sondern endgültiges Verfahren vor der Wahl für solche Zulassungs- und Nichtzulassungsstreitigkeiten vorzusehen. Diese elementaren Dinge, die das Grundrecht auf Wählbarkeit berühren, die sollten vorher geklärt werden.”
Den Populisten würde es so schwerer gemacht, sich als Opfer zu inszenieren, Wahlausschüsse wären mit ihrer Entscheidung nicht mehr alleingelassen - und in Ludwigshafen wäre das Risiko einer Wahlwiederholung deutlich kleiner.
Stand: 10.09.2025 12:58 Uhr